Presse und Texte:
Presse:
Tagesspiegel vom 01.02.2020, Mehr Berlin "Florale Anarchie", Verfasserin Christiane Meixner
taz vom 13.11. 2014 „Berlin mit sparsamen Strich“
Berliner Morgenpost vom 18.08.2013 ,in der Kolumne Kunstsache von Gabriela Waldes
Berliner Morgenpost vom 1.8.2013, Berlin Live „Der Chronist der Stadt“
Berliner Morgenpost vom 22.8.2013, Berlin Live „Berlin- Souvenirs mit Blümchen“
SHZ Sylter Rundschau vom 1. 9. 2011 „Erster Inselmaler zeigt seine Bilder“, Verfasser Jörg Christiansen
Tagesspiegel Artikel 2020

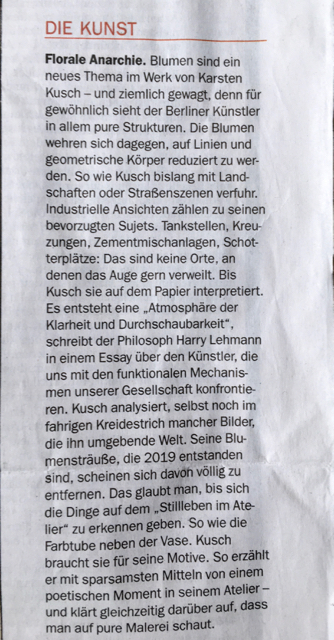
Ästhetik des Kargen
Björn Engholm
In aller Regel lieben die am Sichtbaren, am Realen orientierten Künstler das Pralle, die Üppigkeit der Natur, die Wuseligkeit der Städte, Menschengemenge, die Sonder- und Absonderlichkeiten des Sozialen, und sie umfangen es mit mal impressiven Duktus, und in expressiver Farblichkeit oder mit abstrahierender Expression.
Kaum jemand liebt die karge Ästhetik des Arbeitsalltags, die schnöden Verläufe des Verkehrs, die Unbillen ökonomischen Tuns. Kaum jemand - außer Karsten Kusch. Ihm sind Lagerhallen, Bauplätze, Umschlagstationen, Lastwagenpulks, Kräne oder Kaianlagen, also Orte und Landstriche, die man selten wahrnimmt, an denen man vorüber rutscht, die man lieber um- als durchquert, seit langem Objekt seiner künstlerischen Begierde.
In jüngster Zeit hat es ihm der Hafen von Travemünde besonders angetan. Dieser größte deutsche Ostseehafen mit rund 150 Abfahrten pro Woche, jährlich über 350 000 Passagieren und einem Umschlag von rund 30 Mill. Tonnen, wird von Kusch zeichnerisch vermessen, mit wenigen kargen Strichen, sparsam-dünnem Farbauftrag und unter konsequenter Aussparung aller Details erfaßt er die Konturen, die Umrisse von Fähr- und Containerschiffen, von Kränen, Trucks, Lasterkolonnen, Anglern, Leuchttürmen, Seezeichen, Hafenhäusern,Wasserstraßen......
Was auf den ersten Blick wie eine schnell hingehauchte Skizze erscheint, wie der Entwurf eines Hafenplaners, offenbart bei näherem Augenschein ganz erstaunliche ästhetische Reize. Die Hafenszenerien erzeugen durch ihn Umrißhaftigkeit und die Leerflächen im Bild einen Sog der Imagination im Kopf des Betrachters. Er denkt sich Bewegung ins Bild - und urplötzlich füllt sich die Leere, setzen sich Kräne in Bewegung, laufen Schiffe ein und aus, kurven Truck über Kaie, wird die Dynamik des Hafens spürbar.
Kusch gelingt das schier Unglaubliche: durch extreme Sparsamkeit im Strich und Farbe die pralle Realität des Travemünder Umschlagzentrums erahnen zu lassen, zu empfinden, was Hafen ausmacht, wohl gar die Sehnsucht zu wecken nach der Ferne.
Ein hochtalentierter und bemerkenswerter Zeichner!
Der gezeichnete Blick
Harry Lehmann
Triste Landschaften sind das Motiv, das der Maler Karsten Kusch sucht: Verladehöfe, Tankstellen, Industriehäfen, Möbellager, Zementmischanlagen, Straßenkreuzungen, Auto¬bahnraststätten, Großhandelslager, Güterbahnhöfe, Sand- Kies- und Schotterplätze. All diese Unorte sind für diejenigen, die nichts auf ihnen zu tun haben, unzugängliche Orte. Sie dehnen sich weit in den Stadtraum aus und nehmen große Areale in den Außenrand¬bezirken ein, so dass man immer wieder auf sie stößt oder sie weiträumig umfahren muss. Wer an ihnen vorbeikommt, schaut gewöhnlich über sie hinweg oder an ihnen vorbei; es sind mit einem Wort Orte, an denen man nicht sein möchte und die man nicht sehen will. Was veranlasst nun einen Maler, sich diesen öden Ansichten zuzuwenden? Es gehört längst zum Strategiesortiment des Kunstsystems, irgendein abwegiges Thema zu besetzten, um sich unterscheidbar und wiedererkennbar zu machen. Man stößt auf Themen ohne thematisches Interesse, an denen einzig und allein die Labelfähigkeit des Sujets interessiert. Skepsis ist mithin angebracht gegenüber der Motivwahl der zeitgenössischen Malerei, so dass die Ausgangsfrage angebracht, wenn nicht gar gefordert ist: Sind die gemalten ›Unorte‹ Markenzeichen oder Gehalt? Der Gehalt eines Bildes lässt sich nicht einfach ablesen, man kommt ihm aber über die Malweise auf die Spur. So fällt zunächst einmal auf, dass jene tristen Orte ihre Tristesse verlieren in den Bildern von Karsten Kusch. Von ihrem Grundton her handelt es sich um ›helle Bilder‹, die mit einer dünnen Farbschicht auf weiß grundierter Leinwand gemalt sind, die entweder rein in der Bildfläche stehen bleibt oder schwach eingefärbt wird. Im Extremfall sind wie bei »Schlafen« (Abb. 1) nur noch die Umrisse von Lastwagen, Gebäuden und Straßenkreuzungen zu erkennen, die mit einer dünnen Linie aus schwarzer Ölfarbe auf weißen Untergrund aufgetragen werden. Eigentlich denkt man eher an eine großformatige Zeichnung als an ein Gemälde. Verstärkt wird dieser Zeichencharakter auch dadurch, dass an vielen Stellen die Farblinien mit Zeichenkohle nachgezogen werden. Es gibt in diesem Bild keinerlei gemalte Farbflächen, sondern die einzigen Grautöne entstehen dort, wo die Kohle wie an den Seitenflächen der Laster verwischt wird. Die Leere des Bildraumes atmet die leeren Stunden ein und aus, in denen die Lasterflotten still stehen, ihre Schlafordnung einnehmen, und sich in Reih und Glied aneinander reihen, wie die Schlafsäcke von Trampern. Die schwachen Spu¬ren von rotbrauner Ölfarbe am Horizont und an einigen Fahr¬zeugkanten wirken noch wie der dunkle Abglanz des heraufdämmernden Morgens. Betrachtet man dieses Auto¬bahnbild allerdings nicht bloß für sich, sondern stellt es in den Kontext ähnlicher Bilder, dann scheint dies nicht der primäre Impuls dieser Malerei zu sein. Die vier »Landschaften« (Abb. 2-5) weisen ein ähnliches Sujet wie »Schlafen« auf sie zeigen jeweils eine große Straßenkreuzung mit Fahrzeugen und Lagerhallen, einer Tankstelle, einem Parkplatz, einem MacDonald Imbiss und einen IKEA-Riegel – nur der Hintergrund bleibt diesmal nicht weiß, sondern ist einmal schwach rosa, dann packpapierfarben oder grau getönt. Nimmt man die ganze Werkgruppe in den Blick, dann artikuliert der Zeichencharakter der Ölbildern weniger solche konkreten Motive wie »Schlafen« als das abstrakte Schema einer Verkehrslandschaft. Diese Gemälde haben etwas von Architekturzeichnungen an sich, von Freihandentwürfen der Verkehrswegeplaner, die einen Verkehrsknotenpunkt auf der grünen Wiese und im freien Feld konzipieren. Der Maler geht den umgekehrten Weg; er gewinnt seine Bildideen aus der Erfahrung eines Vorbeifahrenden, der einen Augenblick länger auf die Verkehrswege mit ihren Kreuzungen, Zufahrten und Haltepunkten blickt, er entwirft diese Landschaften nicht auf dem Papier, sondern analysiert das, was aus solchen Entwürfen real geworden ist. Die zeichnerische Konzentration dient also einem viel tiefgründigerem Wahrnehmungsinteresse als der bloßen Versinnbildlichung der je einzelnen Motive: Sie zielt auf das Sichtbarmachen einer zur Lebensweltstruktur zementierten Geometrie. Ein solcher Blick der Kunst ist nicht neutral, er impliziert im Unterschied zur tatsächlichen Architekturzeichnung immer eine bestimmte Haltung gegenüber dem, was sie zeigt. Die Bilden von Karsten Kusch gewinnen ihren ästhetischen Gehalt aus dieser künstlich erzeugten Spannung zwischen technischer Zeichnung und gezeichneter Malerei. Es bleibt immer genug Farbigkeit und malerische Geste vorhanden, um eine poetische Differenz zur technischen Projektion offenzuhalten, obwohl das Werk insgesamt mit seiner Reduktion auf die Linie, dem Leerlassen der Fläche und dem Ausdünnen der Farben auf ebendiese Projektionen verweist. Was zeigt sich aber an diesem feinen Unterschied? Welche Sicht auf diesen Ausschnitt unseres Lebensraumes entwirft hier die Kunst? Eine Sichtweise, die offenkundig weder trist noch heiter, weder romantisierend noch sozialkritisch ist, sondern irgendeinen Punkt zwischen diesen Unterscheidungsmustern sucht, mit denen man normalerweise diese aus dem Bewusstsein getilgten Orte kategorisiert? Doch schauen wir zuvor noch auf die zweite große Werkgruppe, in der es nicht um Verkehrslandschaften, sondern um die Umschlagstellen im Transportsystem wie Industriehäfen oder Verladehöfe geht. Dies sind die Orte, an denen die Verkehrsströme für kurze Zeit unterbrochen sind, an denen die Güter auf den Schienen und Kanälen in der Stadt anlanden, sich ansammeln, sortiert und auf jene Lastwagen verladen werden, die man eben noch auf den Straßen, Tankstellen und auf den Raststätten sah. »Südhafen 2« (Abb. 6) weist so wie die Straßenbilder einen starken zeichnerischen Gestus auf: Zum einen, weil hier die beiden Gleise, auf denen sich der grüne Kran bewegt, zusammen mit dem Kanal in einem gemeinsamen Fluchtpunkt zusammenlaufen, zum anderen, weil die ganze Landschaft aus einer Horizontlinie und diesen vier parallelen Konstruktionslinien aufgefaltet wird. Stellt man diesem Bild »Südhafen 1« gegenüber, wo wiederum ein Kran am selben Ort aus der gleichen Perspektive gemalt wird, dann bemerkt man einen prinzipiellen Unterschied im Bildaufbau: Es ist nicht mehr die Zeichnung mit ihrer Differenz von Linie und Grund, über die sich das Bild generiert, sondern es wird jetzt von zwei aufeinanderstoßenden Farbflächen, konstituiert: ein stumpfen Gelb wird hier gegen ein übersättigtes Rot gesetzt und bildet an dieser Grenzlinie den Horizont. Derselben Werkgruppe gehören auch der »Verladehof Heidestraße« (Abb. 7) und der »Berliner Sandhügel 3« (Abb. 8) an. Der Verladehof ist in ein wässriges rosa Nachtlicht getaucht, die Berliner Sandhügellandschaft mit Bagger ist erneut bloß in seinen Umrisslinien auf die weiße Grundierung mit Ölfarbe gezeichnet. Der Himmel wird beide Male als monochrome dunkelblaue bzw. kadmiumrote Farbfläche gemalt, so dass auch hier der Kontrast zweier Flächen wie schon bei jenem Bild mit Kran am Südhafen die zentrale bildgebende Idee ist. Was sagt dies über den Gehalt der Bilder aus, in denen ein solcher Widerstreit zwischen zeichnerisch exakter Realitätsbeobachtung und surrealen Farbgebung aufgebaut wird? Was sich prinzipiell gegenüber den Verkehrsbildern ändert, die nicht von der Farbfläche, sondern von der Zeichnung her konzipiert sind, ist das innere Verhältnis der statischen und dynamischen Momente im Bild. In beiden Werkgruppen werden Fahrzeuge, Gebäude und Landschaften mit Hilfe von Umrisslinien skizziert. Doch die Wirkung der Zeichnung im Gemälde erfährt eine Umpolung, wenn ihre Linien nicht mehr auf hellem Grund für sich, sondern im Kontrast zu einer kraftvollen Farbfläche stehen. Die Linie verliert an Stabilität, sie verkörpert nicht mehr die Architektonik einer Straßenlandschaft, sondern gibt allen Dingen, deren Umriss sie zeichnet, eine fragile Gestalt. Gerade weil die Farbfläche hier der Gewichtung der gezeichneten Linie dient, bleibt der Himmel in »Berliner Sandhügel 3« abstrakt und wird zum monochromen, kadmiumroten Farbfeld verfremdet. Es kommt in diesem Bild gerade nicht darauf an, ein Stück Himmel zu zeigen, sondern das Geschehen darunter mit einer Farbfläche zu interpretieren. Auf der weißen Leinwand wird die Linie zur stabilen Struktur, in Differenz zur Farbmassen wird sie zur flüchtigen Kontur. Im einen wie im anderen Fall korrespondiert die Maltechnik mit dem gewählten Sujet. Anders als eine Straßen¬kreuzung gehören jene Sand¬hügel¬landschaften, wie sie im Umfeld von Großbaustellen entstehen, zu den kurzlebigen und sich permanent verändern¬den Erscheinungen im urbanen Raum. Wer Tag für Tag an diesen Mondlandschaften im Stadtbild vorbeifährt, bemerkt wie sie größer und kleiner werden, an einem Ort verschwin¬den und an anderer Stelle wieder emporwachsen. In »Berliner Sandhügel 3« (Abb. 8) gewinnen solche Wahrneh¬mungen aber noch auf ganz andere Weise eine ästhetische Präsenz: Die Sandhügel selbst sind ›leere Hügel‹, so dass man sich ihre stoffliche Präsenz leicht hinzu- und hinwegdenken kann; mit Zeichenkohle ist eine flüchtige Bewegungslinie eingezeichnet, die sich vor dem Bagger entlang schlängelt, das Dach des Kabinenhäuschens wird mit ein paar Strichen verdoppelt, so als ob es sich ohne Last wieder aufrichten würde, und der Greifarm scheint sich in ein paar zusätzlichen Skizzenlinien nach vorn zu strecken. Am stärksten aber zeigt sich das Entstehen und Vergehen dieser Landschaft dort, wo der kaminrote Himmel in schmalen Spuren in die Sandhügel rinnt – so wie die Farbe noch nicht getrocknet ist, ist diese Industrielandschaft im Fluss. Der Zeichenkohlenstrich, die Leerfläche, die ausgelaufenen Farbnasen – all dies sind auf der einen Seite Zeichen des Unfertigen und Unvollendeten, welche nicht das abgeschlossene Bild, sondern den Malprozess reflektieren. Und diese Prozesshaftigkeit der Malerei ist auf der anderen Seite nicht nur ein Stilmittel, sondern macht die Unstetigkeit jener Umschlagpunkte erfahrbar, an denen Waren, Güter, Rohstoffe und Baustoffe in Bewegung sind. Wo sich derart das Sujet wie bei Karsten Kusch im Medium der Malerei reflektiert, wo sich mit denselben zeichnerischen Bildtechniken einmal ein statischer und ein andermal ein dynamischer Wesenszug artikuliert, dort kann man davon ausgehen, dass das Thema ›Unorte‹ nicht bloß der Wiedererkennung, sondern einer Erkenntnissuche dient. Doch selbst wenn es klar ist, dass das immer wieder variierte Grundmotiv nicht wie ein Label, sondern wie ein Werk funktioniert, selbst dann ist damit die Frage noch nicht geklärt sondern wird durch den Kunstanspruch der Bilder erst aufgeworfen , ob diese Bildersuche erfolgreich war oder nicht, ob diese Bilder tatsächlich eine Einsicht generieren oder eine vorhandene Sichtweise nur im Medium der Malerei reproduzieren. Was die beiden Motivtypen miteinander verbindet, was also die Umschlagplätze mit den Straßenkreuzungen vereint, ist, dass sie Knotenpunkte in den Verkehrsadern der Gesellschaft sind. Sichtbar wird der pulsierende Stoffwechsel mit seinen Waren- und Rohstoffströmen, wenn sich die Lasterflotten in den Raststätten sammeln oder ein Sandhügelgebirge in der Innenstadt entsteht. Man kann als Künstler an solchen Phänomenen verächtlich vorbeischauen, sie romantisch verklären, expressionistisch überhöhen oder gesellschafts¬kritisch hinterfragen. An all diesen Realitätsverhältnissen ist Kuschs Malerei nicht interessiert. Sie macht diese Unorte zu ihrem Thema und ist der Wirklichkeit mit einem analytischen Stil verpflichtet; sie meidet den erhabenen Ton und kommt in ihrer Skizzenhaftigkeit unprätentiös daher; sie verzichtet auf die expressiven Gesten und setzt keine Menschen ins Bild, die sich in diesen Industrielandschaften verlieren – die Kabinen der Bagger, Kräne und Lastkraftwagen sind leer, nur auf den »Südhafen 1« hat sich einmal schemenhaft ein Hund verirrt. Mit welchem Blick schaut nun der Maler Karsten Kusch auf diesen Wirklichkeits¬ausschnitt, welche Sichtweise auf dieses Stück Realität manifestiert sich in seinem Werk? Ich denke, es ist ein ›Blick der Akzeptanz‹, der hier Bild um Bild entwickelt wird und dessen normativer Impuls in einer reflexiven Gelassenheit gegenüber der westlichen Lebensform mit seinen Transportsystemen, seinen Warenströmen und seinem Güterumschlag besteht. Was diese analytischen Bilder ausstrahlen ist eine Atmosphäre der Klarheit und Durchschaubarkeit von Funktionsmechanismen, welche der Gesellschaft seit über einem Jahrhundert im Rücken liegen, sie konstituieren und unterminieren. Die Bilder wollen die eigene Angewiesenheit auf die stofflichen Zirkulationsprozesse weder negieren noch annullieren, sondern sie aus der Distanz betrachten und ins Leben ihrer Betrachter integrieren. Erst der distanzierte Blick auf die Welt, welche man vierundzwanzig Stunden am Tag in Anspruch nimmt, gibt einem die Freiheit, sich souverän zu ihr zu verhalten. An diesem Punkt dokumentieren und antizipieren die Bilder von Karsten Kusch mit ihrem Duktus eines zeichnerischen Entwurfs etwas von einer kollektiven Souveränität gegenüber der eigenen Kultur, über deren Unorte man nicht hinwegsieht, sondern die man im Blick behält. Gemälde waren immer schon Identifikations¬flächen für eine andere Sicht auf die Welt; in der alten Malerei vermitteln sich diese Erfahrungsmuster primär über die Wahl des Sujets und einen bestimmten Stil, zu Zeiten der Avantgarde fast ausschließlich über das Experiment mit Farbe und Leindwand. Heutzutage sucht die Kunst ihren ästhetischen Gehalt zwischen diesen Extremen, in einer Balance zwischen dem ›Was‹ und dem ›Wie‹, in einer ästhetischen Formensprache, die ihr lebensweltliches Thema trifft. In diesem Sinne geht es diesem Werk hier weder um Schönheit, noch um Erhabenheit, noch um Kritik, sondern um Sachlichkeit gegenüber der eigenen Existenz.
Karsten Kusch – Malerei
Cara Schweitzer
„Autofahrt ... rast weiter über menschenlosen Platz, Gelb keuchend, zwischen Träumen und Erwachen, Rings Nebel, die Gebüsche blinder machen, Das Auto dreht ... in einem Satz.“
Verlassene, von gelblich gleißendem Licht der Straßenlaternen beleuchtete Plätze und Straßen sind Motive der jüngsten Bilder des Berliner Künstlers Karsten Kusch. Parallel zur Bildfläche verlaufende Wege und dynamische Diagonalachsen, die Häuserecken oder Kreuzungen beschreiben, strukturieren die malerische Komposition. Lastwagen mit grellen Scheinwerfern schleichen auf diesen nächtlichen Straßen ebenso wie Autos, die mit hoher Geschwindigkeit aus dem Dunkel aufzublitzen scheinen, das in diffusen Rotbraun- und Grautönen gemalt ist. Berlin bei Nacht – ist das nicht ein banaler Topos, von dem schon der Mythos um die Stadt in den goldenen Zwanzigern zehrt und der bereits Thema der Expressionisten war, wie das im Ausschnitt zitierte Gedicht von Ernst Blass (1911) bezeugt. Doch, wer in trüber Novembernacht in einem alten Auto über den Großen Stern gleitet, kann diese schon viel zitierten Metaphern gleichsam als persönliche Erfahrung erleben. Das verschwommene Scheinwerferlicht der Vorausfahrenden ruft ein Schwindelgefühl hervor, löst Orientierungsverlust aus – Nachtblind nennt man das – ist der Lastwagen auf der Nebenspur Freund oder Feind? Karsten Kuschs Nachtbilder zeigen keine spezifischen Berliner Orte und man kennt sie dennoch. Sie sind Erinnerungsbilder, entstanden nach nächtlichen Fahrten mit dem Auto, die der Künstler als Plakatierer unternimmt und die zu seinem Alltag ebenso gehören, wie der Gang ins Atelier. Alltagserfahrungen und Vorgefundenes sind stets Voraussetzung seiner Bilder. Die Nacht als Thema der Malerei hat eine lange Tradition. Nicht nur Berliner Künstler, die sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert intensiv mit dem Straßenleben befaßten, etwa Vertreter der Neuen Sachlichkeit, haben diese Stadt bei Nacht gemalt. Die Nacht ist zugleich eine Metapher für die Erfindung von Malerei und Zeichenkunst. Ein Höhepunkt in der Geschichte der Nachtmalerei war bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts erreicht. Zu dieser Zeit galt das Malen von Nachtstücken als ästhetische Herausforderung, bei der Künstler ihr Können mittels raffiniert beleuchteter Szenen unter Beweis stellten. Karsten Kuschs „Nachtstücke“ spielen mit dieser Geschichte und sind zugleich neue Bilder, deren Laternen, weite Baulücken, Plätze und schwere Laster, nächtliche Stimmungen in heutigen Städten widerspiegeln. Farbauftrag und Perspektive erzeugen den Eindruck von Bewegung und evozieren scheinbar jenen Blick, mit dem der Künstler die Straßenszenen zuvor aus dem fahrenden Auto heraus, wie in Zeitlupe wahrgenommen hat. Auf diese Weise reflektieren die jüngsten Arbeiten ihre Entstehung aus Erinnerungsbildern, denn diese sind immer zugleich auch fließende, bewegte Bilder. Assoziationen an Roadmovies werden geweckt; die jüngsten Gemälde oszillieren zwischen der Illusion von Bewegung und Stillstand. Als Vorlagen nutzt der Künstler lockere, bisweilen nur auf Umrisse reduzierte Kohle- und Bleistiftskizzen, eben nicht Fotografien. Zeichnung und Malerei gehen bei den Bildern von Karsten Kusch kreative Wechselwirkungen ein, setzen einander gleichsam voraus. Dies gilt insbesondere für jene Werke, die Gewerbefreiflächen in der Berliner Innenstadt zeigen, beispielsweise die Umgebung des ehemaligen Lehrter Stadtbahnhofs, des West- und Nordhafens, oder auch der Beusselbrücke. Hoch aufgetürmte, sich nahezu täglich verändernde Sandhaufen, Siloanlagen und schlichte, meist auf einfache Kuben reduzierte Architekturen sind ideale Projektionsflächen für die farbigen und vom Gegenstand zusehends abstrahierte Stadtlandschaften. Der weite Blick, den die Brachen ermöglichen, scheint ein Grund zu sein, warum sich der Künstler immer wieder mit diesen Orten auseinandersetzt. Auch sein Atelier an der Grenze der Berliner Bezirke Mitte und Wedding, in der Nähe des ehemaligen Mauerstreifens, läßt Aussichten auf noch unbebaute Zonen der Stadt zu. Laster, Güterwaggons und Verladekräne bewegen sich scheinbar behäbig auf diesen Bildern und tangieren spielerisch die kompositorischen Prinzipien von Masse und Größenverhältnissen aus. Die Motive spiegeln zwar für Berlin sehr typische Blicke wider, hauptsächlich handeln sie jedoch von Malerei. Mehrere Bilder sind auf einer Leinwand übereinander geschichtet, solange bis der gewünschte kompositorische Aufbau erreicht ist. Die Horizontlinie teilt wie bei „Nummer 5“ (2004) die Bildflächen in zwei Zonen. Eine in expressive rot, pink und orange Töne getauchte Freifläche auf der ein sympathischer, wie ein Modellwagen anmutender Laster seiner Arbeit nachgeht, ein hohes rotes Haus und ein ebenso hoher Hügel, der über dem Horizont wie ein Mittelgebirge herausragt, darüber ein verlaufener, milchig weißer Himmel – mittels ihrer malerischen Umsetzung fordern diese Motive das an sich triste Image, das diesen Stadträumen anhaftet, geradezu heraus. „Nummer 5“ signalisiert ein groß an den rechten Bildrand gesetztes Schild und verleiht der Szene auf Grund dieser, im Kontext des Bildes, sinnlosen Bezeichnung einen geradezu humoristischen Zug. Karsten Kuschs gemalte Industriegebiete beschönigen diese Orte weder, noch demonstrieren sie einen Glauben an technischen Fortschritt, wie dies für viele Werke vergleichbaren Sujets im Stil des Sozialistischen Realismus typisch ist, und die für eine Auseinandersetzung mit der Stadt in der zeitgenössischen Berliner Kunstszene zahlreiche Anknüpfungspunkte bieten. Sie implizieren auch keinen sozial-kritischen oder dokumentarischen Blick. Vielmehr nehmen Sie die menschenleeren Brachen und Industriezonen als Stadt/Landschaften hin, ohne die dort manövrierenden Maschinen als Helden zu feiern. Die auf Grundformen reduzierte Architektur und mit schlichten Linien gezogenen Straßen strukturieren abstrakte farbige Bildkompositionen. Die gemalten vorgefundenen Alltagsdinge lassen sich ebenso wie die Stadtlandschaften zu einer umfangreiche Werkgruppe zusammenstellen mit der sich der Künstler bereits während seines Studiums an der Berliner Hochschule der Künste befaßte. Entwickelt wurde dieses Thema auf Grund seiner intensiven Beschäftigung mit Stillebenmalerei. Sessel, Gamat-Durchlauferhitzer, fast leere Regale und Mäntel sind Hauptakteure dieser Bilder. Sie fungieren jedoch nicht als Indizien in einem Kriminalfall, sind weder schuldig noch unschuldig, sondern waren offensichtlich immer schon anwesend, gehören dazu. Umgebung wird nur mittels einer Bodenkante angedeutet, so daß die Objekte nicht in einem bestimmten Raum zu verorten sind. Diese gemalten Gegenstände legen nicht viel wert auf ihre Individualität und doch erzählen sie Geschichten. Etwa, der „Gamat“ (2000), der bereits im Atelier installiert war und der für Insider schnell als Relikt des sanitären Alltags in der DDR zu identifizieren ist. Nicht das „Wesen“ oder „Wesenhafte“ beispielsweise eines Sessels werden hervorgekitzelt und die Betrachter nicht auf die „wahre“ Schönheit dieser, dem Künstler selbst wohl lieben Gegenstände hingewiesen. Es geht auch nicht darum diese privaten Dinge im Sinne der Objektkunst oder als gemalte Readymades in den Kunstkontext zu stellen. Sie werden nie arrangiert und sind daher kaum als Stilleben zu bezeichnen. Die Bilder zeigen vielmehr einen subjektiven Blick auf die Dinge selbst. Sie sind bis auf das „Bord“ (2002) selten in frontaler Ansicht komponiert, sondern meist leicht schräg von oben oder von der Seite, eben so, wie man sie aus einer Bewegung, beim Vorbeigehen aus dem Augenwinkel heraus wahrnimmt. Die sonst stillen Dinge werden auf diese Weise lebendig, scheinen etwas zu erzählen oder zu handeln. So schwebt der über einen Bügel gehängte Bademantel eher an der Wand und brilliert mit seinen fröhlichen Punkten in lockerem und leger verlaufendem Farbauftrag. Er wird zu einem Gegenüber, der den Wunsch nach Gemütlichkeit und Wärme repräsentiert. Er ruft Erinnerungen an einen Morgen nach lang durchzechter Nacht hervor oder gar Spott über das Image des typischen Berliners, der sich nicht scheut solche Kleidung täglich in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Bilder von Karsten Kusch versuchen einen Moment, einen Blick auf Dinge und alltägliche Erfahrung sichtbar werden zu lassen, ohne die Zeit und ihre Stimmungen festzuhalten, zu fixieren und einzufrieren. Sein prozessuales Vorgehen während des Arbeitens am Bild erweist einmal mehr, daß Malerei ein geeignetes Medium ist, um solche Bilder entstehen zu lassen.
Stuttgart 2005
- Die Autorin ist Kunsthistorikerin und arbeitet seit 2005 als wissenschaftliche Assistentin am Kunstmuseum Stuttgart. -